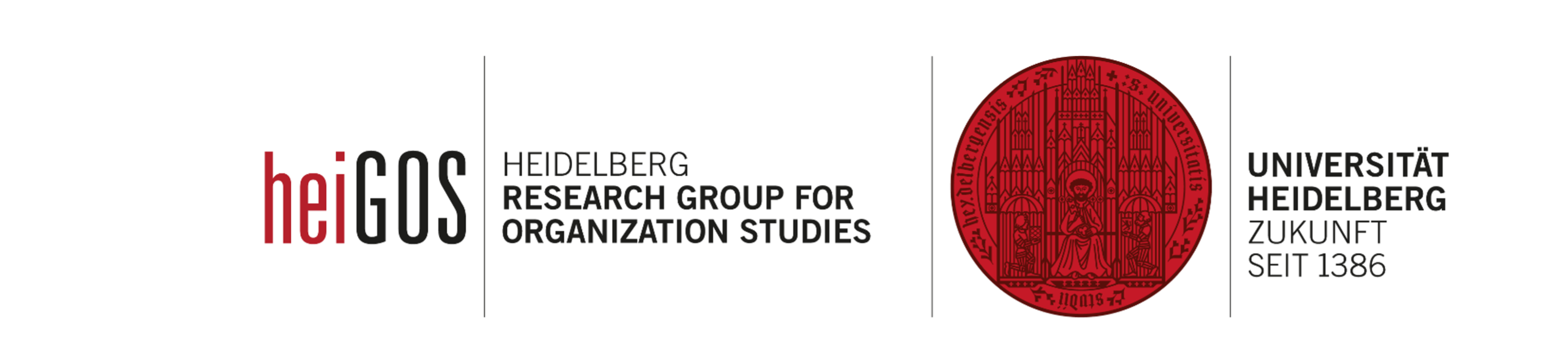Stellen Sie sich vor, Sie treffen sich mit Ihren Freunden. Sie wissen nicht so recht, was sie tun sollen. Mia schlägt vor, zum Skatepark unter der Brücke zu gehen, weil sie weiß, dass Linus dort gerne ist. Sie selbst hat darauf keine Lust. Lina geht es ebenso, aber sie hält zurzeit immer zu ihrer Freundin Mia, weil es dieser in der Beziehung zu Linus nicht so gut geht. Lina mag es nicht, mit dem Skateboard zu fahren und kann mit den Leuten im Skatepark nichts anfangen, die sich dort immer zur Schau stellen. Linus selbst hatte Ärger mit einem seiner Skater-Freunde und will dort zurzeit nicht hingehen. Aber Mia zuliebe nickt er, gerade weil ihre Beziehung seit einiger Zeit nicht mehr so gut ist. Auch Jakob, Linus‘ Freund hat auf einen solchen Ausflug zum Skatepark keine Lust und würde lieber zu dem Beach-Volleyball-Feld gehen, wo er letzten Sonntag mit einer der Spielerinnen einen Flirt begonnen hat. Aber wenn drei aus der Gruppe das wollen, fügt er sich der Mehrheit, wie er es immer tut. Seine Zugehörigkeit zur Clique ist ihm wichtig. Auch Sie selbst finden den Vorschlag wenig inspirierend, aber machen mit, weil Sie gerade mit einem Lehrbuch beschäftigt sind und sich nicht selbst Gedanken über eine Alternative machen wollen. Mia sagt: „Also, das scheint eine gute Idee zu sein, oder?“ Alle nicken und machen sich auf den Weg zum Skatepark.
Sie machen also als Gruppe etwas, was kein Einzelner in der Gruppe tun wollte. Sie gehen zum Skatepark unter der Brücke und langweilen sich zunächst. Doch dann kommt wider Erwarten Stimmung auf und Sie verbringen gerne Ihre Zeit am Skatepark. Hinterher sagen alle, dass es eine gute Idee war und schön, dass alle dahin wollten. Sie finden, dass es ein gelungener Nachmittag war. Die eigenen Vorbehalte sind schnell vergessen.
Bitte arbeiten Sie an diesem Beispiel heraus, welche Bedeutung der Ausgang eines Ereignisses auf dessen retrospektive Deutung haben kann (1). Zeigen Sie bitte auf, wie das Geflecht sozialer Beziehungen zu einer Kollektiventscheidung führt, welche nicht durch die Interessen der Einzelnen an einem Skateparkbesuch getragen sind (2). Arbeiten Sie bitte heraus, wie es zur Konformität mit dieser Kollektiventscheidung kommt und diese Konformität in der Lage sein kann, die kollektiven Deutungsweisen des Ereignisses zu beeinflussen (3).
Lösung:
Es existieren Situationen, in denen Menschen in einer Gruppe Dinge tun, die niemand in der Gruppe für gut hält. In diesem Fall machen die Mitglieder einer Gruppe etwas, weil sie glauben, dass die anderen Mitglieder der Gruppe sich das so wünschen. Die Gruppenmitglieder stellen den Vorschlag nicht infrage, weil sie Konflikte vermeiden und einen Konsens erzielen möchten. Sie haben eine Reihe von Erwartungen über die Erwartungen und Prioritäten der anderen Gruppenmitglieder. Auf diese Weise kommt ein Ereignis zustande, dass kein Einzelner in der Gruppe wirklich wollte. Aber es geht gut und alle sind hinterher zufrieden, dass sie in den Skatepark gegangen sind.
(1) Dieser gute Ausgang prägt dann auch die Deutung des Ereignisses und seines Zustandekommens selbst. Wenn Wochen später in der Rückschau darüber gesprochen wird, wie sich die Situation eigentlich ergeben hat, wird der gute Ausgang des gemeinschaftlichen Unterfangend die anfänglichen Unlustgefühle der Einzelnen mit großer Wahrscheinlichkeit überstrahlen. In der Theorie des Sozialkonstruktivismus wird beschrieben, wie unsere Sinnesorgane, unsere Kognitionen und unser Gedächtnis keine Abbildungen der äußeren Realität produzieren, sondern Wirklichkeiten konstruieren, welche ermöglichen, dass wir uns in ihnen zurechtfinden.
(2) Die Mitglieder der Gruppe haben eine Situation geschaffen, die für sie individuell zunächst nicht als wünschenswert angesehen wird. Aber sie verhalten sich konform in Bezug auf die jeweils unterstellten Erwartungen und Prioritäten der relevanten Anderen. Konformität bedeutet Übereinstimmung und Anpassung an die Einstellung sowie das Verhalten der ganzen Gruppe. Sie erleichtert das gesellschaftliche Zusammenleben. Angetrieben wird Konformität u. a. durch die (oft hintergründige) Angst vor sozialer Ausgrenzung.
(3) Das geht so weit, dass der Wille zur Konformität sogar die Wirklichkeitswahrnehmung beeinflussen kann. Als Beispiel hierfür könnte man sich das Experiment des Psychologen Solomon Asch von 1951 ansehen (vgl. Asch, Solomon E. (1951): “Effects of Group Pressure Upon the Modification and Distortion of Judgment,” in: Harold Guetzkow (Hrsg.): Groups, Leadership andMen, Pittsburgh: Carnegie Press, S. 177–190). Er wollte Gruppenzwang und Gruppenkonformität untersuchen und konzipierte dafür das heute berühmte „Asch-Experiment“. In diesem Experiment ließ er Proband*innen die beiden gleich langen von vier ansonsten verschieden langen Linien benennen. Die längere und kürzere Linie waren mit bloßem Auge sehr leicht zu erkennen. Bis auf eine einzige teilnehmende Person waren alle anderen Teilnehmer eingeweiht und benannten fälschlicherweise einhellig eine längere als die kurze Linie. Überraschenderweise entschieden sich die meisten Proband*innen für den Mehrheitsbeschluss – obwohl sie genau wissen mussten, dass dieser falsch war. 50 Prozent der Teilnehmer*innen gaben in mehr als der Hälfte der Abstimmungsrunden eine falsche Antwort, um sich der Mehrheit anzuschließen. Rund 5 Prozent zeigten regelrecht blinden Gehorsam. Nur 25 Prozent meinten, dass hier offenbar eine Mehrheit versuche, das Ergebnis zu beeinflussen. Dieses Experiment zeigt auf, wie stark der Konformitätsdruck sein kann – teilweise bis hin zum Hinterfragen der eigenen Wahrnehmung.