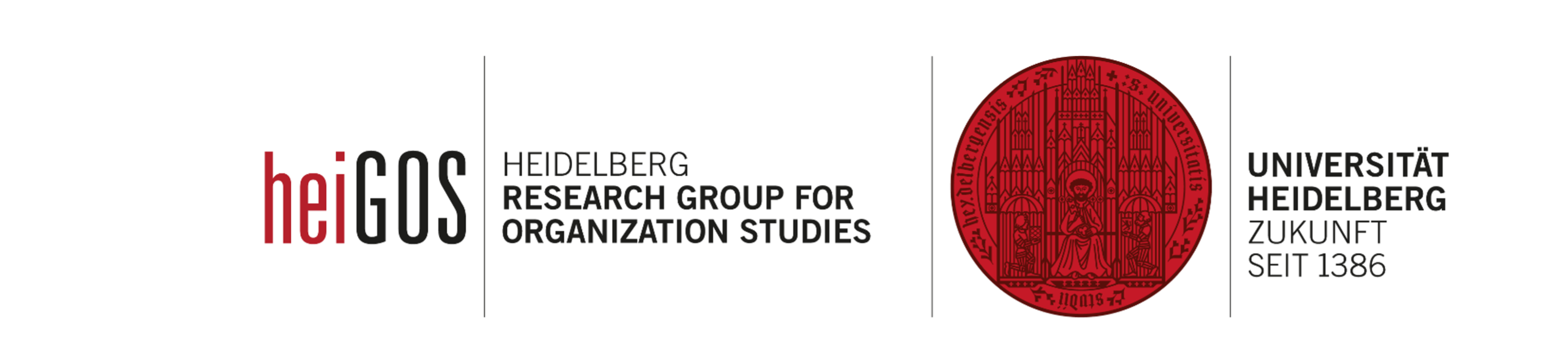- Inwiefern entfalten Deutungsmuster in alltäglichen Situationen Handlungsrelevanz? Wie können wir herausfinden, wie handlungsrelevant Deutungsmuster sind?
Deutungsmuster sind für uns kognitive und normative Elemente des kollektiven Wissensvorrats, die in Handlungssituationen aktiviert werden und Orientierung schaffen. Sofern sie kollektiv Geltung erlangen, haben sie in alltäglichen Situationen Handlungsrelevanz. Aber wie kollektive Deutungsmuster in Interaktionszusammenhängen zur Geltung kommen und sich in konkrete Handlungen übersetzen, ist eine offene empirische Frage. Insbesondere mittels Beobachtungen, Experimenten, aber auch Inhaltsanalysen von Interviews und Dokumenten können wir Antworten auf die Frage geben, wie handlungsrelevant Deutungsmuster in konkreten Interaktionssituationen werden. Während wir die prinzipielle Handlungsrelevanz unterstellen können, muss die konkrete Handlungsrelevanz empirisch geprüft und nachgewiesen werden.
- Müssen Deutungsmuster immer implizit oder latent vorhanden sein, oder gibt es auch explizite Deutungsmuster?
Unter Deutungsmustern sind zunächst übergeordnete Sinnstrukturen zu verstehen, welche im kollektiven Wissensvorrat einer Gesellschaft bzw. einer Kultur verankert sind. Da Menschen immer Teil einer Kultur sind, prägen die jeweiligen Deutungsmuster einer Kultur die Wahrnehmung und das Handeln ihrer Mitglieder oft unbewusst – ob sie es wollen oder nicht. Insofern sind Deutungsmuster oft implizit und werden von den Akteuren in der Regel nicht reflektiert. Diese Perspektive des vornehmlich impliziten Charakters von Deutungsmustern wird insbesondere durch Oevermann (2001) vertreten.
Demgegenüber geht Ullrich (1999) davon aus, dass Deutungsmuster Akteuren auch in manifester und reflektierter Form zur Verfügung stehen können, um ihr Handeln und ihre Sicht auf die Welt zu begründen. (Ullrich 1999: 430). Erneut kann hier das Beispiel der Kindererziehung aufgegriffen werden: Viele Menschen sind sich der Vielzahl unterschiedlicher Erziehungsstile bewusst und kennen die mit ihnen jeweils verbundenen Deutungs- und Handlungsregeln. Entscheiden sich Eltern für einen bestimmten Erziehungsstil, vielleicht nach der Lektüre eines Elternratgebers, können sie auf das Deutungsmuster als explizite Sinnstruktur zurückgreifen und ihre Erziehung zum Beispiel gegenüber Verwandten oder Lehrern erklären.
- Wie unterscheiden sich Deutungsmuster von Stereotypen?
Stereotype können wir als gesellschaftlich etablierte und schemahafte Schablonen zur vereinfachten Kategorisierung des Sozialen verstehen. Damit haben sie also ähnlich wie Deutungsmuster eine kollektive Verbreitung und strukturieren die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Im Unterschied zu Deutungsmustern fehlt ihnen jedoch der Bezug zu einem jeweils spezifischen objektiven Handlungsproblem, zu dessen Bearbeitung sie beitragen.
Außerdem beanspruchen Deutungsmuster einen empirisch begründeten Einfluss auf das Handeln der Akteure gemäß der entsprechenden Deutungs- und Handlungsregeln. Sicherlich entfalten auch Stereotype eine Handlungsrelevanz, etwa in Form von Diskriminierung oder Vorurteilen. Die inhaltlichen Handlungsannahmen eines Stereotyps hinsichtlich der betreffenden sozialen Gruppe sind jedoch in der Regel nicht empirisch haltbar. So können stereotype und patriarchale Vorstellungen von Männlichkeit durchaus handlungsrelevant in der Personalauswahl sein, die mit ihnen verbundenen Annahmen werden im Berufsalltag jedoch nicht erfüllt. Man denke in diesem Zusammenhang auch an die empirisch unhaltbaren Vorurteile, welche Stereotype auf Grundlage des Geschlechts, der Haarfarbe, des Berufs oder der Herkunft verarbeiten.
- Können Deutungsmuster auch instrumentell und strategisch sein, oder schließt sich dies aus?
Deutungsmuster sind Bestandteil des kollektiven Wissensvorrats einer Kultur oder Gesellschaft. Um Teil dessen zu werden, müssen sie habitualisiert, externalisiert, objektiviert und internalisiert werden. Aufgrund dieses kollektiven Charakters der Entstehung, Reproduktion und Veränderung von Deutungsmustern entziehen sie sich der strategischen Einflussnahme durch einzelne strategische Akteure. Sie sind nicht strategisch, sondern habitualisierte kollektive Schemata, die in einer Kultur zur Verfügung stehen, um objektive Handlungsprobleme zu bearbeiten. Darauf bezogen sind sie instrumentell, aber nicht strategisch verfügbar.
Darüber hinaus stehen in Institutionenanalysen in der Regel die einzelnen Akteure weniger im Mittelpunkt, sondern vielmehr die institutionalisierten Wissensordnungen, in welche diese eingebettet sind. Mit der Frage nach einer strategischen Nutzung von kollektiv geteilten Deutungsmustern würde sich der Fokus hin zu einer akteurszentrierten Analyse verschieben. Soll der strategische Einsatz von Deutungsschemata in den Vordergrund einer Analyse gesellt werden, gibt es alternative Ansätze zum Deutungsmusterkonzept, die diesen Aspekt stärker betonen. Beispielhaft könnte hier die frame analysis angeführt werden, welche an Goffmans Rahmentheorie anknüpft oder an die Idee der „frame selection“ in der Rational-Choice-Theorie.