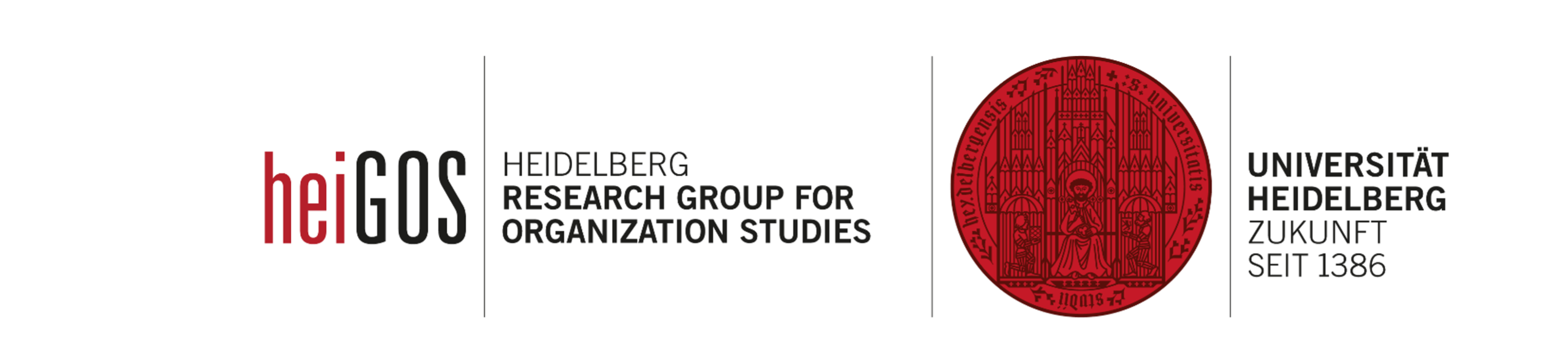- Welche Möglichkeiten gibt es, wissenschaftlich mit der Selektivität in der Beobachtung umzugehen?
Jede Beobachtung ist notwendigerweise selektiv, da niemand von uns die Komplexität einer Situation objektiv abbilden kann. In einem wissenschaftlichen Verfahren wollen wir aber erreichen, dass wir uns unserer Wertungen und Selektivitäten bewusstwerden und daran arbeiten, allzu starke Verzerrungen zu vermeiden. Dazu empfiehlt die qualitative Sozialforschung erstens die Arbeit an der Herstellung einer künstlichen Naivität, also dass wir uns unserer Vorurteile, Wertungen und Voreinstellungen bewusstwerden und versuchen, uns von diesen freizumachen oder sie hintanzustellen. Zweitens sollen die Beschreibungen von Situationen und Handlungen möglichst dicht und uninterpretiert stattfinden. Der Prozess der Beobachtung und der Beurteilung sollen streng getrennt werden. Erst kommt die dichte Beschreibung, dann die Interpretation. Drittens sollen Beobachtungen am besten zu zweit und ihre Auswertung in Interpretationsgemeinschaften durchgeführt werden. Im Streit um Deutungen von Beobachtungen werden die eigenen Selektivitäten sowie die der anderen erkennbar und können bei der Interpretation berücksichtigt werden. Viertens ist es sehr wichtig, zu jeder Zeit seinen erstellten Bewertungsmaßstab zu reflektieren und konsequent an den jeweiligen Anforderungen zu orientieren. Protokolle sollten zeitnah, ausführlich und sorgfältig angefertigt werden. Es ist zwar nicht möglich, seine eigene Wahrnehmung zu korrigieren, aber man kann mit Offenheit und ohne Vorurteile versuchen, eine Situation anzugehen und sein eigenes Bild zu ergänzen (Hermeneutischer Zirkel).
- Sie wollen mittels Beobachtung herausfinden, wie Menschen während einer Pandemie mit Maßnahmen umgehen, welche eine physische Distanz vorschreiben. Bitte schlagen Sie vor, wie Sie bei einer solchen Beobachtungsstudie vorgehen wollen.
Nachdem die Untersuchungsfrage festgelegt wurde (Wie gehen Menschen während einer Pandemie mit Maßnahmen, welche eine physische Distanz vorschreiben um?), wird in einem nächsten Schritt der Gegenstand der Beobachtung festgestellt. Da in diesem Fall absolut jeder Mensch im vorgesehenen Beobachtungsraum betroffen ist, kann man entweder entscheiden, den Untersuchungsgegenstand weiter einzugrenzen oder offen zu agieren. Im nächsten Schritt werden der Ort, die Zeit und die Dauer der Beobachtung festgelegt. Nun ist es wichtig, den Ort festzulegen, an dem die Beobachtung stattfinden soll. Dies sollte je nach Wohnort entschieden werden, da sich in manchen Bundesländern die Regeln stark unterscheiden. Ein guter Ort für eine derartige Beobachtung wäre ein Ort, an dem sich tendenziell viele Menschen aufhalten und die Einhaltung von Distanzregeln überhaupt erst an Relevanz gewinnen. Dies könnte an einem Bahnsteig, in einer Bahn, in einem vielbesuchten Park oder auch in einem Supermarkt sein. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Dabei sollte man aber auch beachten, dass an manchen Orten die Distanzregeln strenger durchgesetzt werden als an anderen. In einem Supermarkt beispielsweise gibt es Markierungen und das Personal ist angewiesen, auf die Einhaltung von Distanzregeln zu achten. In einer Straßenbahn ist das eher weniger der Fall und die Fahrgäste müssen dies stärker in Eigenverantwortung tun. Man muss sich ebenfalls der eigenen Grenzen bewusst sein. Es wäre wahrscheinlich recht schwierig, einen ganzen Tag lang in der Bahn zu sitzen oder sich länger als ein paar Stunden in einem Supermarkt aufzuhalten. An anderen Orten, wie einem vielbesuchten Park, stehen Distanzregeln wiederum weniger im Vordergrund. Hier muss eine gute Balance gefunden werden. Wichtig ist, im nächsten Schritt einen Beobachtungsleitfaden zu erstellen, der vorgibt, was von wem zu beobachten ist, was wesentlich ist und was weniger wichtig ist, wie die Beobachtungen gedeutet werden dürfen, wo die Beobachtung stattfindet und wie genau sie protokolliert wird.
Der nächste Schritt besteht darin, die Form der Beobachtung festzulegen. Für das Erkenntnisinteresse unserer Untersuchung wäre eine qualitativ offene, teilnehmende Beobachtung passend, da wir uns selbst an diesen Orten bewegen sollten, um unsere Erkenntnisse zu validieren. Die Beobachtung könnte unstrukturiert sein, da ein zu enger Beobachtungsleitfaden der zu erwartenden Varianz im Feld nicht gerecht würde. Außerdem sollte die Beobachtung verdeckt sein, da eine offene Beobachtung hier das Verhalten der Menschen beeinflussen könnte, vor allem da die physische Distanz vorgeschrieben ist und sogar polizeilich sanktioniert werden kann.
- Was gilt es zu beachten, wenn man das Protokoll einer qualitativen Beobachtung schreibt?
Bei einer qualitativen Beobachtung ist die Erstellung eines ausführlichen und genauen Protokolls unerlässlich. Die Verlässlichkeit der Methode der Beobachtung hängt entscheidend von der Technik der Protokollierung ab. Es muss genau auf das Verhalten und die Situation des Subjektes geachtet werden. Die Interpretation sollte niemals die Beschreibung ersetzen. Einige wichtige Fragen sollte man sich vor der Beobachtung stellen (vgl. Lamnek 2010). (1) Wann soll protokolliert werden? Allgemein sollte möglichst wenig Zeit verstrichen sein zwischen der Beobachtung und der Festhaltung im Protokoll, da Einzelheiten vergessen werden oder anders in Erinnerung geblieben sein können. Häufig ist eine Protokollierung während der Beobachtung zwar störend, grobe Notizen jedoch sinnvoll, um Wichtiges nicht zu vergessen. Da der Verlust an Exaktheit des Protokolls unmittelbar nach der Beobachtung am geringsten ist, sollte wenn möglich direkt danach protokolliert werden. Wichtig ist auch, (2) wie protokolliert wird. Als Möglichkeiten bieten sich handschriftliche Notizen, elektronische Notizen oder aber in bestimmten Fällen auch Videoaufzeichnungen oder ein Tagebuch an. Eine Kombination aus handschriftlichen Stichpunkten während der Beobachtung und ausführlicher elektronischer Aufzeichnung nach der Beobachtung ist empfehlenswert. Im nächsten Schritt ist wichtig, (3) was genau protokolliert wird. Der zu protokollierende Inhalt ordnet sich immer dem Erkenntnisinteresse der Forschungsfrage unter. Das bedeutet, dass besonders auf Regelmäßigkeiten, Handlungsmuster und -typen geachtet werden soll.
- Welche ethischen Probleme können bei teilnehmenden Beobachtungen auftreten?
Bei einer verdeckten Beobachtung können die Beobachteten nicht über die Untersuchung informiert sowie über die Risiken aufgeklärt werden. Dies muss aber im Nachhinein geschehen. Deswegen muss hier die ethische Frage der Durchführbarkeit vor der Untersuchung geklärt werden. Die Beobachtung muss nicht nur vollkommen anonymisiert durchgeführt werden, sondern es muss auch sichergestellt werden, dass den Beobachteten durch die Beobachtung kein irgendwie gearteter Schaden entsteht. Aber auch bei einer offenen Beobachtung, bei welcher der Aufklärungspflicht im Vorhinein Genüge getan wird, muss sichergestellt werden, dass die Beobachteten durch die Beobachtung keinen Schaden nehmen.