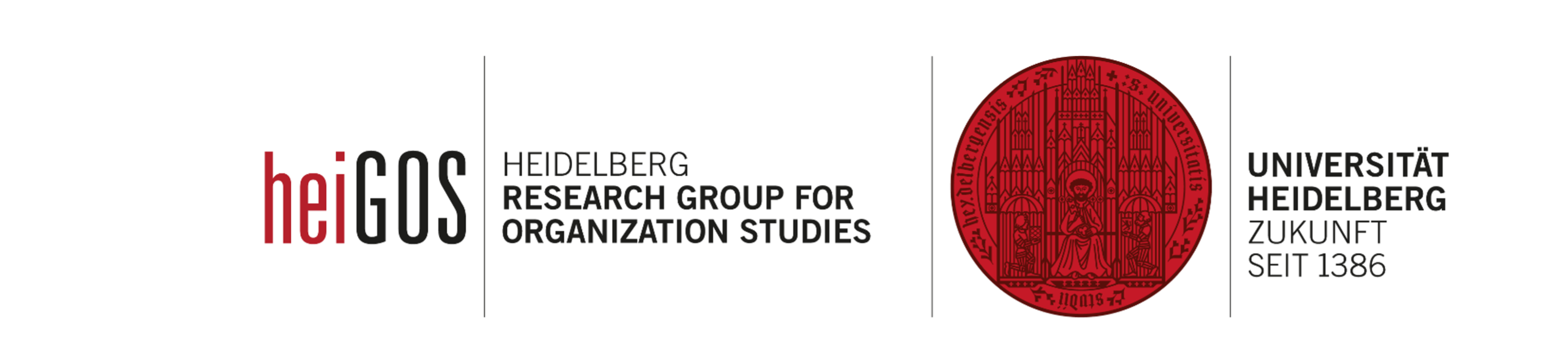- Sie wollen herausfinden, ob sich verschiedene Alterskohorten im Sprachgebrauch sowie in der Verwendung von Zusatzzeichen (Smileys, Symbole) in den sozialen Medien unterscheiden. Sie wähend dazu WhatsApp-Textnachrichten für eine Inhaltsanalyse aus. Wie gehen Sie dabei vor?
Sie interessieren sich dafür, wie die Alltagskommunikation durch Sozialisation sowie die gewählten gesellschaftlichen Darstellungsformen einer Person bestimmt wird. Dies drückt sich Ihres Erachtens sowohl im Duktus (Sprachstil und Grammatik) von alltäglichen Textnachrichten als auch im Einsatz von Zusatzzeichen, sogenannten Emoticons oder Emojis aus. Diese Zusatzzeichen definieren zum einen die Mitteilungsebene des Geschriebenen oder ersetzen zum anderen Inhalte, zum Beispiel Objekte oder Eigenschaften von Objekten.
In einem ersten Schritt sollte darauf basierend die Fragestellung ausformuliert werden; hier zum Beispiel: Inwiefern unterscheiden sich Alterskohorten in ihrem Sprachgebrauch sowie in der Verwendung von Zusatzzeichen (Smileys, Symbole) in den sozialen Medien? Im nächsten Schritt werden die Richtung der Analyse, die Codiereinheit, die Kontexteinheit, und die Auswertungseinheit festgelegt. Nachdem das Material für die Untersuchung festgelegt ist (Zufallsstichprobe oder andere Auswahlmethode), wird die inhaltsanalytische Methode gewählt. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring sieht zwei verschiedene Vorgehensweisen vor: die induktive Kategorienbildung und die deduktive Kategorienbildung. Die Wahl der geeigneten Vorgehensweise hängt von der Art der Daten ab – keine ist besser oder schlechter.
Bei der deduktiven Kategorienbildung werden die Kategorien durch die Forschungsliteratur bestimmt. Wird die induktive Kategorienbildung gewählt, werden die Kategorien aus dem Material der Analyse selbst heraus gewonnen. Hier wird folgendermaßen vorgegangen: In einem ersten Schritt der Analyse wird das Material paraphrasiert. Danach wird eine erste und eine zweite Generalisierung/Reduktion des paraphrasierten Materials durchgeführt. Aus der zweiten Reduktion lassen sich Kategorien zur Codierung erstellen. Die Kategorien sollten mehrfach überprüft werden, nach Fragen wie „Spiegeln die Kategorien die Inhalte angemessen wieder?“ und „Wurden die Kategorien in einem angemessenen Verhältnis gebildet, also decken sie ein ausgeglichenes inhaltliches Spektrum ab?“. In diesem Fall ist eine Frequenzanalyse von Vorteil, vor allem auch um die Nutzung von Smileys und anderen Symbolen festzustellen. Nun wird die Codierung auf das ganze Material angewandt. Vom Arbeitsaufwand wird dies der größte Teil der Analysearbeit sein. Schließlich folgen die weiterführende Auswertung und die Interpretation der Analyse.
Was könnten die Ergebnisse einer solchen Inhaltsanalyse sein? Wir könnten z. B. feststellen, dass es Sozialisationseffekte gibt. Vielleicht stellen wir fest, dass Menschen, welche noch in einer Kultur des Briefeschreibens groß geworden sind, sich im Duktus der Textnachrichten eher an vollständigen und grammatikalisch richtigen Sätzen orientieren, dass dies aber auch mit dem kulturellen Kapital variiert und dass sich dieser Unterschied bei jüngeren Kohorten (sagen wir, der unter 30-Jährigen) verliert. Aufgrund der gewählten Darstellungsform der Person, insbesondere einer gesuchten Jugendlichkeit der älteren Kohorten (sagen wir, der 55- bis 65-Jährigen), nutzen diese eher mehr Emoticons und aufgrund des Duktus eher ergänzende Emoticons als die Kohorte der unter 30-Jährigen, welche eher weniger Emoticons und häufiger auch ersetzende Zusatzzeichen verwenden (vgl. als Illustration z. B. Tschernig, Kristin und Katharina von Hertzberg (2015): „Altersgruppenspezifisches Nutzungsverhalten von Bildzeichen bei WhatsApp“, in: mediensprache.net (letzter Zugriff 6.6.2022) oder Koch, Timo, Romero Peter und Clemens Stachl (2020): „Predicting Age and Gender from Language, Emoji, and Emoticon Use in WhatsApp Instant Messages“).
- Welche Probleme treten bei einer quantitativen Inhaltsanalyse auf, die man bei einer qualitativen Inhaltsanalyse vermeiden kann?
Die quantitative Inhaltsanalyse orientiert sich vorrangig an manifesten Kommunikationsinhalten, d. h., sie verzichtet auf eine hermeneutische Interpretation der Inhalte oder – einfacher ausgedrückt – auf ein Zwischen-den-Zeilen-Lesen. Dadurch kann es zu Missverständnissen oder Unklarheiten kommen, worauf ein Text anspielt. In einer Frequenzanalyse werden zum Beispiel Wörter gezählt, die in verschiedenen Kontexten eine jeweils andere Bedeutung haben. So kann etwa das Wort „Integrität“ eine moralische Bedeutung haben, wie z. B. im Sinne von „zu seinen Werten stehen“ oder eine informationstechnologische, die sich auf die Korrektheit von Daten bezieht. Erst im Kontext lässt sich dies erkennen. In einer quantitativen Inhaltsanalyse kann der Kontext aber bestenfalls eng begrenzt mit erhoben werden, während eine qualitative Inhaltsanalyse darauf ausgerichtet ist, diesen Kontext mit zu analysieren und zu rekonstruieren. Sie kann dadurch solche Missverständnisse besser vermeiden und latente sowie manifeste kontextbezogene Kommunikationsinhalte herausarbeiten.
- Wie wählt man die Sequenzen für eine hermeneutische Sequenz‐analyse aus?
Die Sequenzen werden an der Fragestellung orientiert ausgewählt. Wir beginnen mit einer vielversprechenden Sequenz. Dabei ist es aber kein Problem, wenn wir feststellen, dass unsere Wahl doch nicht so gut war. Denn es ist nicht zentral, an welcher Stelle wir unsere hermeneutische Analyse beginnen, da mehrere Sequenzen vergleichend herangezogen werden und uns jede Sequenz Rückschlüsse auf die Relevanzstrukturen der Befragten eröffnet.