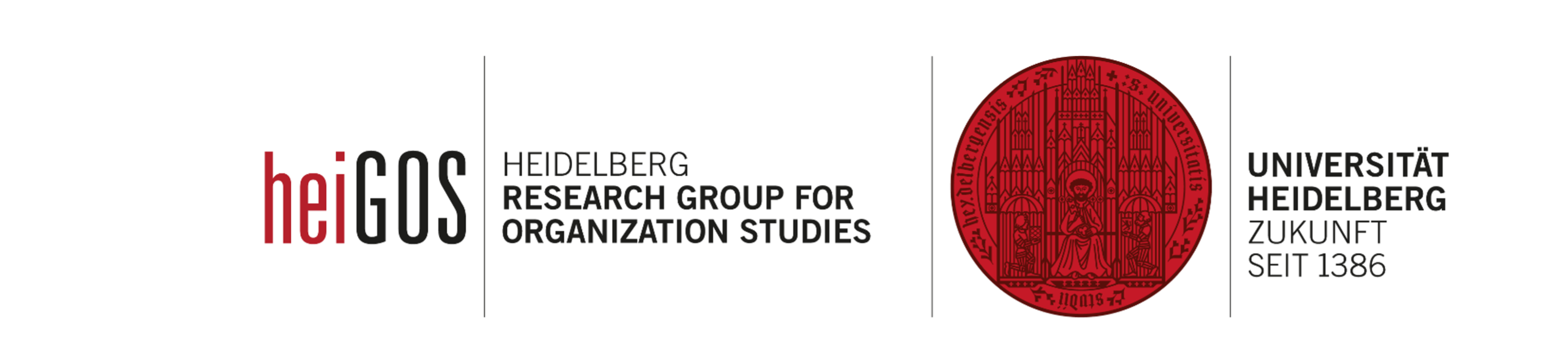Eine Videoanalyse zum Selbststudium: Das “Blue Eyes Experiment”:
- Sehen Sie sich bitte die Dokumentation zum Alltagsrassismus basierend auf dem Experiment von Jane Elliot an.
- Entwickeln Sie eine Fragestellung zum Thema und formulieren diese aus. Wählen Sie bitte eine zehnminütige Sequenz aus dem Video aus, die Sie für die Beobachtung vorsehen wollen. Entscheiden Sie sich für die Art der Beobachtung sowie die Art der Protokollierung.
Video zur Übung:
ZDFneo (2019): Der Rassist in uns (letzter Aufruf 08.12.2020).
Lösung:
Brown Eyed – Blue Eyed Workshop
Ursprünglich wurde das Workshopkonzept „Brown Eyed – Blue Eyed“ in den 1960er-Jahren von der US-amerikanischen Grundschullehrerin Jane Elliott[1] entwickelt. Sie wollte durch diese Übung den Schüler:innen, die nicht von Rassismus betroffen waren, aufzeigen, was Diskriminierung bedeutet und wie sie sich im Alltag anfühlt. Inzwischen wird der Workshop in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten durchgeführt – eine besondere Anwendung hat er auch in Unternehmen gefunden. Der im Workshop geschaffene Mikrokosmos kann dabei helfen, Alltagsdiskriminierung zu erkennen und inkludierende Diversity-Prozesse zu fördern (siehe Sommer und Schlicher 2016). Im Folgenden wird eine deutsche Variante dieses Workshops mittels einer Videoanalyse soziologisch-qualitativ ausgewertet. Dabei wird der Frage nachgegangen: Warum schweigen Menschen und greifen bei offensichtlicher Diskriminierung nicht ein?
1 Datenerhebung
Videomaterial kommt sehr oft bei ethnographischen Arbeiten als Teil oder Ergänzung einer (teilnehmenden) Beobachtung zum Einsatz. Die grundsätzliche Prämisse, die Daten dort zu erheben, wo sie „natürlicherweise“ vorkommen, wird davon nicht verletzt (vgl. Schnettler und Knoblauch 2009: 278).
„Technische Aufzeichnungen und insbesondere Videoaufnahmen erlauben es, Daten im Feld zu erheben, die aufgrund ihrer Fokussierung, ihrer Komplexität und ihrer Intersubjektivität eine vollkommen neue methodische Qualität besitzen“ (Schnettler und Knoblauch 2009: 278).
Es gibt zwei Arten auswertbaren Videomaterials: Zum einen das Material, das die Forschenden selbst bezogen auf eine Fragestellung produzieren (siehe dazu Heath, Luff und Hindmarsh 2010), und zum anderen akzidentale Dokumente, also bereits existierendes Material, das zu anderen Zwecken erstellt wurde (siehe dazu Reichert und Englert 2011). Auch bei der folgenden Analyse handelt es sich um die Auswertung akzidentaler Dokumente, und zwar einer Dokumentation der ZDF-Produktion „Der Rassist in uns“ aus dem Jahr 2014.
2 Datenanalyse, Interpretation und Diskussion
Das erhobene oder ausgewählte Videomaterial ermöglicht ferner eine „Fokussierung“ der Ethnographie (siehe Knoblauch 2001), die folglich „feldintensiv“ und „datenextensiv“ ist (Schnettler und Knoblauch 2009: 278). Die Qualität des Materials liegt dabei nicht in der Absicht, möglichst „authentische“ Aufnahmen oder Verhaltensdynamiken als Beweise bisher unbekannter Taten zu produzieren – der Schwerpunkt einer Videoanalyse liegt bei der Interpretation. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie man geeignete Ausschnitte zur Bildung eines Korpus an relevanten Daten auswählt, um letztendlich eine interpretative Feinanalyse durchzuführen.
2.1 Sampling
Die Fülle von Daten entsteht aus der Kombination synchroner und diachroner Beobachtungsaspekte (vgl. Schnettler und Knoblauch 2009: 280). Die recht einfache Aneignung der Technik lässt große Datenmengen produzieren – selbst für Dokumentarfilme wie diesen, der hier ausgewertet wird, ist es nicht sinnvoll, das vollständige Videomaterial auszuwerten. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Rohdatenmenge auf relevante Sequenzen zu reduzieren und für die Analyse aufzubereiten. Dies geschieht durch Rubrizieren und Indexierung von Sequenzen (vgl. Schnettler und Knoblauch 2009: 280). Dabei ist es unerlässlich, die Selektionskriterien für die zu analysierenden Sequenzen zu formulieren. Diese ergeben sich aus dem Verhältnis zwischen dem Datenkorpus und methodischer Reflexion.
Nun, anhand welcher Relevanz werden die Sequenzen ausgewählt? Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten: Man kann sich an der Fragestellung und dem Forschungsinteresse orientieren oder mit einer Beobachtung beginnen und im fortschreitenden Vergleich weitere Sequenzen auswählen (vgl. Schnettler und Knoblauch 2009: 280).
„Im günstigsten Fall ist die Fokussierung das Ergebnis eines integrativen Forschungsvorgehens, bei dem das zunächst ‚unschuldig‘ gewonnene, recht lose in den analytischen Blick genommene Videodatum im Verlaufe seiner fortschreitenden Auswertung selbst die schrittweise Kalibrierung der Forschungsperspektive liefert“ (Schnettler und Knoblauch 2009: 280f.).
Dies entspricht der Methode der Grounded Theory und wird als „theoretical sampling“ bezeichnet (s. dazu Stübing 2004).[2] Im Folgenden werden wir orientiert am bereits definierten Forschungsinteresse die Sequenzen auswählen.
2.2 Transkription
Bevor man nun zur Analyse und Interpretation übergeht, erfolgt ein Zwischenschritt: die Transkription. Sie ist für die methodische Aufarbeitung des Materials zwingend notwendig. Zur Bewältigung dieser Aufgabe kann man auf eine Reihe bereits existierender Transkriptionsverfahren zurückgreifen. In Anlehnung an den Ansatz von Bergman et al. aus dem Jahr 1993 wurden mittlerweile zwei vereinfachte Varianten des Verfahrens entwickelt (s. dazu Raab 2001, 2002 und Raab und Tänzler 1999 sowie Schnettler 2001 und Heath 1997a zum alternativen Ansatz).
In dieser Übung wurde, wie das Beispiel 1 zeigt, folgendermaßen transkribiert: Alle Dialoge zum relevanten Zeitpunkt wurden aufgenommen und die Bilder dokumentieren zusätzlich das wesentliche Geschehen. Dabei wurde besonders auf die Reaktion bzw. den Mangel einer Reaktion der Teilnehmer:innen in bestimmten diskriminierenden Sequenzen geachtet.[3]
Beispiel 1: Transkript 4: 35:40 – 38:37 und 41:09 – 41:58

Jürgen Schlicher: Bist du gerade abgelenkt?
Blauäugiger Teilnehmer: Nein
Jürgen Schlicher: Weil du dir diese Plakate so anguckst. Steh auf, lies dieses Plakat vor. Und ich möchte, dass ihr danach im Uhrzeigersinn die Plakate vorlest.
Blauäugiger Teilnehmer: Wenn es den Blüüs, hier nicht gefällt, dann sollen sie dahingehen, wo sie hergekommen sind.
Jürgen Schlicher: Den was?
Blauäugiger Teilnehmer: Den Blüüüs.
Jürgen Schlicher: Den Blüüü?! Das ist verkehrt.
Restliche Teilnehmer:innen: [lachen]
Jürgen Schlicher: Lies es richtig vor.
Blauäugiger Teilnehmer: Blue eyes.
Jürgen Schlicher: Buchstabiere mir mal eben das englische Wort blue.
Blauäugiger Teilnehmer: B L U E.
Jürgen Schlicher: B L U E. Dann buchstabiere bitte das englische Wort eyes.
Blauäugiger Teilnehmer: E Y S.
Jürgen Schlicher: Das englische Wort eyes. Plural von eye. Die Augen.
Blauäugiger Teilnehmer: E Y S.
[Nach der Unterbrechung]
Jürgen Schlicher: Matthias wir machen weiter. Du warst bei dem Plakat. Steh auf, lies es noch mal vor. Und lies es jetzt richtig vor.
Blauäugiger Teilnehmer: Wenn es den blue eyes hier nicht gefällt, sollen sie doch dahin gehen, wo sie hergekommen sind.
Jürgen Schlicher: Wir müssen wirklich von vorne an wieder anfangen: Wie würdest du das englische Wort blue schreiben.
Blauäugiger Teilnehmer: B L U E.
Jürgen Schlicher: Wie würdest du das englische Wort eyes schreiben?
Blauäugiger Teilnehmer: E Y S.
Jürgen Schlicher: Das war der Fehler, den du schon vorhin gemacht hast.
Blauäugiger Teilnehmer: E S, E S…
Jürgen Schlicher: E Y E S, genau. Kann das Wort, das da steht, blue eyes heißen? Die Antwort lautet?
Blauäugiger Teilnehmer: Nein.
Jürgen Schlicher: Gut!
[Im Interview]
Blauäugiger Teilnehmer: Man fühlt sich schon sehr minderwertig. Also, hätte nicht gedacht, dass das so, dass mich das so mitnimmt. Weil ich dachte, ich wär ein bisschen gestärkter, sag ich jetzt mal. Und könnte damit besser umgehen.
2.3 Analyse
Eine sozialwissenschaftliche Analyse des visuellen Materials kann nicht nur durch die einfache Beobachtung erfolgen (vgl. Schnettler und Knoblauch 2009: 282). Demgegenüber hat sich bereits eine methodische Ausrichtung etabliert, die ihre Ursprünge in der Konversationsanalyse hat und sich stark Sequenzen orientiert (vgl. Schnettler und Knoblauch 2009: 282).[4] Die vorliegende Analyse und Interpretation ist angelehnt an die Arbeiten von Knoblauch et al., die in den letzten zehn Jahren entwickelt wurden und eine kommunikative Analyse mit dem soziologischen Konstruktivismus (Berger und Luckmann 1969) verbinden.[5]
„Die Analyse kommunikativer Gattungen (Luckmann 1988) zielt nicht nur auf einzelne Sequenzen, wie die Konversationsanalyse, sondern sucht nach verfestigten Mustern und Formen sprachlicher und nichtsprachlicher Kommunikation und bemüht sich dann, die Probleme kommunikativer Handlungen zu identifizieren, als deren Lösung sie diese Muster ansieht. Je bedeutender die damit gelösten Probleme, umso verpflichtender und fester sind die Lösungen für diese Probleme. Gattungen bilden sozusagen den ‚institutionellen Kern‘ in der gesellschaftlichen Kommunikation“ (Schnettler und Knoblauch 2009: 282).
Die Datenanalyse erfolgt sequenzanalytisch (vgl. Schnettler und Knoblauch 2009: 283). Sie macht sich damit den Zeitpunkt der Ereignisse zunutze. Sie orientiert sich am gesampelten Material, alterniert zwischen Grob- und Feinanalyse und sucht in Anwendung des hermeneutischen Zirkels die Antworten auf aufgeworfene Fragen durch das Material (vgl. Schnettler und Knoblauch 2009: 283).
Die Ergebnisse werden in Forschungsprotokollen zusammen mit den Transkripten festgehalten, um die Rückbindung an den zugrundeliegenden Datenkorpus sicherzustellen (vgl. Schnettler und Knoblauch 2009: 283). Des Weiteren bilden sie den notwendigen Zwischenschritt zur Fundierung der entstehenden theoretischen Generalisierungen (vgl. Schnettler und Knoblauch 2009: 283).
Die Datenanalyse des Workshop-Videos „Brown Eyed – Blue Eyed“ erfolgte sequenzanalytisch. So sind bereits in den ersten Minuten die für die Fragestellung interessanten Dynamiken zu beobachten: Am Eingang während der Anmeldung verhält sich der Kursleiter Jürgen Schlicher deutlich unterschiedlich gegenüber den blauäugigen und den braunäugigen Teilnehmer:innen: Zu den braunäugigen Teilnehmer:innen ist er sehr zuvorkommend, während er die blauäugigen Teilnehmer:innen sehr despektierlich behandelt. Aus Transkript 1 geht hervor, dass er durch seine sehr direkte Art die blauäugigen Teilnehmer:innen nicht nur verunsichert, was ihre sprachlichen Reaktionen auf ihn ersichtlich machen, sondern dass er ihnen auch körperlich sehr nah kommt. Damit kommen bereits zu diesem Zeitpunkt nicht alle Teilnehmer:innen klar und einige verlassen den Workshop. Als Jürgen Schlicher gegenüber einem älteren Teilnehmer unhöflich auftritt (vgl. Transkript 2), sind zwei wichtige Aspekte zu beobachten: Zunächst fühlt sich der ältere Mann selbst unwohl in der Situation und er wehrt sich gegen die Unhöflichkeit. Während Schlicher den älteren Mann konsequent duzt, siezt der Mann den Kursleiter:
Jürgen Schlicher: Kannst du schon lesen?
Blauäugiger Teilnehmer: Meinen Sie mich?
Jürgen Schlicher: Mhm!
Blauäugiger Teilnehmer: Was denken Sie? Was meinen Sie? Was stellen Sie sich vor?
Jürgen Schlicher: War eine ganz normale Frage, die mit ja oder nein zu beantworten.
Blauäugiger Teilnehmer: Ja, meine auch! Ich frage Sie dann wieder.
Jürgen Schlicher: Okay. Kannst du schon lesen? Ja oder nein?! Die Frage ist nicht schwer zu beantworten!
Blauäugiger Teilnehmer: Doch, aber sie ergibt sich von sich selbst.
Jürgen Schlicher: Okay! Lies einfach vor was da steht (Transkript 2).
Eine zweite wichtige Beobachtung aus derselben Situation erfolgt in dem Moment, in der die Situation kippt und der ältere Mann den Workshop verlässt:

Zwar wurde von den anderen Teilnehmer:innen bereits registriert, wie Jürgen Schlicher mit dem blauäugigen Teilnehmer:innen umging, jedoch griff niemand ein. Wie die letzten zwei Bilder aus Transkript 2 dokumentieren, löst die Situation nur vereinzelt Unsicherheit bei den Teilnehmern:innen aus – der Rest der Gruppe wirkt eher nicht sehr skeptisch.
Im Workshop-Raum selbst, nachdem sich die braunäugigen Teilnehmer:innen Kaffee und Essen genommen haben, erklärt der Kursleiter, wie der Workshop ablaufen wird und was passieren wird, sobald die blauäugigen Teilnehmer:innen den Raum betreten. Dass die braunäugigen Teilnehmer:innen wie im Theater in einem Zuschauerraum sitzen und umgeben sind von großen Plakaten, die in schwarzen Buchstaben auf weißem Hintergrund diskriminierende Aussagen über Blauäugige zeigen (vgl. Transkript 3, Bild 6: „Blauäugige ruinieren unser Bildungssystem“), scheint nur eine Teilnehmerin zu irritieren. Sie äußert ihre Skepsis gegenüber dem Workshop:
Braunäugige Teilnehmerin: Darf ich kurz etwas anderes sagen, heee?
Jürgen Schlicher: Nö!
Restliche Teilnehmer:innen: [lachen]
Jürgen Schlicher: Möchtest du gerne?
Braunäugige Teilnehmerin: Ich dachte, ich sag’s trotzdem. Ich finde, mir persönlich ist es auch wichtig, wie ich auch reagiere. Weil ich sitze…mir geht es total scheiße.
Jürgen Schlicher: Ja! Ja!
Braunäugige Teilnehmerin: Ja, weil ich habe überhaupt keine Lust dazu, dieses Spiel überhaupt mitzuspielen.
Jürgen Schlicher: Ja?!
Braunäugige Teilnehmerin: Hab so ´ne Wut in mir. Und ich hab schon ein, zwei Leute angesprochen. Die haben gesagt: Neee, wird schon nicht so schlimm sein. Die werden auch ihren Kaffee kriegen oder sonst was. Und ich merke, das kann ich kaum ertragen.
Jürgen Schlicher: Magst du gucken, wie es denen geht?
Braunäugige Teilnehmerin: Ja.
Jürgen Schlicher: Dann mach das.
Braunäugige Teilnehmerin: Dann mache ich das (Transkript 3).
Als sie jedoch aufsteht und den Workshop verlassen möchte, stößt ihr Vorgehen nicht auf Zustimmung, obwohl ihre Bedenken in dem Moment nachvollziehbar sind. Im Gegenteil: Der Rest der Gruppe scheint die Protestaktion eher nicht zu verstehen, was deutlich an der Mimik zu erkennen ist (vgl. Transkript 3, Bild 3–5). Nachdem die Frau den Raum verlassen hat, gelingt es dem Kursleiter problemlos, die Teilnehmer:innen davon zu überzeugen, dass die Reaktion der Frau falsch war. Einer offensichtlichen Lüge stimmt sogar ein braunäugiger Teilnehmer zu und auch der Rest äußert keine Einwände:
Jürgen Schlicher: Oh Gott, was konnten wir wieder viel lernen? Ist euch was aufgefallen? Zum Thema Augenfarbe? Habt ihr gesehen, welche Augenfarbe sie hat?
Braunäugiger Teilnehmer: Ja, blaue Augen.
Jürgen Schlicher: Ja, sicher.
Braunäugiger Teilnehmer: Deswegen hat sie sich auch so…
Jürgen Schlicher: Deshalb hat sie sich auch so komisch verhalten. Hehehe, ja. Leicht blond (Transkript 3).
Nachdem die Blauäugigen den Raum betreten haben, beginnt Jürgen Schlicher offensiv despektierlich mit ihnen umzugehen. Eine blauäugige Person nach der anderen soll aufstehen und die diskriminierenden Plakate laut vorlesen. Schlicher demütigt und verunsichert die Blauäugigen: Er wirft einem Blauäugigen in Minute 35–38 vor, dass er die englische Sprache nicht beherrsche (vgl. Transkript 4). Er nutzt dabei auch eine Tafel und einen Textmarker, um eine Lehrer-Schüler-Situation zu simulieren und dadurch die ganze Gruppe auf die Fehler der zu demütigenden Teilnehmer:innen hinzuweisen. Dass die Strategie Schlichers wirkt, zeigen auch die Reaktionen der Braunäugigen: Nicht nur, dass die Leute bei einem offensichtlich falschen Verhalten nicht einschreiten, sondern sie zeigen auch eine Art der Zufriedenheit und Zustimmung (vgl. Transkript 4, Bild 5).
Eine der Schlüsselsituationen passiert, als eine später dazugekommene blauäugige Teilnehmerin einen Stuhl nimmt, der eigentlich für Braunäugige vorgesehen war (vgl. Transkript 5). Der Kursleiter drängt sie dazu, aufzustehen und sich in die Mitte zu den anderen Blauäugigen zu setzten. Er sucht hierfür die Unterstützung der anderen Teilnehmer:innen, die er zwar bekommt, jedoch nur von den Braunäugigen, die in der Mehrheit sind. So bezeichnet er die Abstimmung als einen Akt der Demokratie. In den begleitenden Interviewpassagen äußern die braunäugigen Teilnehmer:innen Unverständnis für die Hartnäckigkeit der blauäugigen Frau:
Braunäugiger Teilnehmer: Das war jetzt doch das ziemliche Theater von der Frau aus meiner Sicht. Denn, ob ich mich jetzt, sagen wir so, ich nehme an einem Workshop teil und das ist das Arena für Blauäugigen, dann kann ich mich auch dahinsetzten. Ich bin… Ich fand das eigentlich unnötig (Transkript 5).
Braunäugiger Teilnehmer: Warum wollte sie gleich da oben sitzen? Sie wollte von Anfang an, ich denke mal so wie ´ne Position zeigen: Sie ist was Besseres. Muss ich ehrlich sagen, so kam sie mir vor (Transkript 5).
Aus den Passagen wird deutlich, dass der Kursleiter als Autoritätsperson zu diesem Zeitpunkt nicht nur erreicht hat, dass die braunäugigen Teilnehmer:innen nicht eingreifen, sondern dass sie sogar der Meinung sind, dass sich die blauäugigen Teilnehmer:innen mehr beugen müssten. Das Gefühl geben sie den Blauäugigen auch im Raum: So merkt die angesprochene Frau, dass sie aufstehen und sich einen neuen Platz suchen muss. Als sie feststellt, dass es keinen gibt, bietet ihr ein jüngerer blauäugiger Mann seinen an, was dazu führt, dass eine weitere Teilnehmerin keinen Platz mehr hat und sich auf den Boden setzen muss. Diese Dynamik reflektiert sie auch im Interview und erläutert, dass sie in so einer Situation erwartet hätte, dass jemand aus der Gruppe der Braunäugigen reagiert:
Blauäugige Teilnehmerin: Das fand ich auch wieder sehr toll von der Gruppendynamik her. Dadurch, dass ein jüngerer Herr direkt bereit war, ihr ein Platz anzubieten. Allerdings dürfte er das nicht ausführen. Da hätte ich mir dann doch gewünscht von der anderen Seite, also von den Braunäugigen, dass da jemand Solidarität gezeigt und gesagt hätte: Nun aber lasst sie mal da sitzen, anstelle dass sie sich dann auf den Boden setzen müssen oder stehen müssen (Transkript 5).
Dieselbe Teilnehmerin verlässt das Workshop aufgrund dieses Ereignisses, kommt jedoch schnell wieder zurück, nachdem sie von den Organisatoren des Workshops dazu überredet wurde. Diesmal ist sie bereit, sich auch auf den Boden zu setzten (vgl. Transkript 6):

Der Höhepunkt des Workshops wird erreicht, als die blauäugigen Teilnehmer:innen aufstehen müssen und die diskriminierenden Aussagen laut vorlesen sollen. Dies läuft nicht einwandfrei, denn es herrscht generelles Unwohlsein bei den Blauäugigen. Zwei Teilnehmende brechen aus diesem Grund den Workshop ab (vgl. Transkript 8 und 9) und äußern sich verwundert im Interview, warum ihnen niemand gefolgt ist und wieso die Braunäugigen so bereitwillig mitgemacht haben, obwohl die Grenzen im Umgang mit manchen Teilnehmer:innen längst überschritten wurden:
Blauäugiger Teilnehmer 4: Dass man eine ganze Gruppe so manipulieren kann, irgendwie nee, dass sie wirklich glauben, was er sagt. Und das nicht hinterfragen. Dafür aber ´ne andere Gruppe dann zur Rechenschaft ziehen. Das ging mir so gegen den Strich, nee, ich dachte mir, entweder du gehst jetzt oder explodierst gleich (Transkript 8).
Die Verwunderung über das Nicht-Eingreifen ist vielleicht am deutlichsten am Ende des Workshops nachzuvollziehen. Nachdem alle Teilnehmer:innen einen Wissenstest gemacht haben, werden die Ergebnisse laut vorgelesen (vgl. Transkript 11 und 12). Der Test war jedoch so schwierig formuliert, dass er nicht zu bestehen war – letztendlich kamen die Fragen aus dem nicht-europäischen Kulturkontext. Jürgen Schleicher bittet all diejenigen, die mehr als 13 Punkte im Test hatten und damit bestanden haben, aufzustehen. Das waren alle braunäugigen Teilnehmer:innen. Diese Szene zeugt nicht nur von offensichtlicher Demütigung der Blauäugigen, sondern verwundert über den Mangel an Reaktionen aus den Reihen der Braunäugigen, gerade wenn man berücksichtigt, dass dieser Gruppe die Lösungen des Tests vorab gegeben worden sind.
2.4 Interpretation und Diskussion
Im Anschluss an das Experiment wurde eine Gruppendiskussion mit allen Teilnehmenden geführt. In dieser äußerten sich die blauäugigen, aber auch die braunäugigen Teilnehmer:innen negativ zum Geschehen. Beide Gruppen berichteten, dass sie sich während des Workshops unwohl gefühlt hatten. Sie erzählten auch von ähnlichen Erlebnissen aus dem Alltag – von Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus. Wie sind demnach die analysierten Situationen zu erklären? Warum griffen die Teilnehmer:innen nicht ein, obwohl der moralische Aufforderungscharakter dieser Situationen so hoch war? Und warum folgten sie nicht denjenigen, die aus Protest den Workshop verließen?
Hier spielt vor allem der experimentelle Kontext eine maßgebliche Rolle. Gerade weil die Teilnehmer:innen darüber aufgeklärt wurden, dass es sich um ein Experiment handelt, folgten sie bewusst den Regeln des Kurses und respektierten den Kursleiter als eine Autoritätsperson. Des Weiteren gibt es psychologische Erklärungen zu der Frage, warum Personen in bestimmten Situationen nicht eingreifen. Insbesondere Zuschauereffekte werden häufig als Erklärung angeführt.[6] Darunter versteht man das Phänomen, dass Zuschauer nicht eingreifen, wenn sie Zeugen einer Straftat, Diskriminierung, Rassismus o. Ä. werden und dass die Wahrscheinlichkeit eines Eingriffs abnimmt, je mehr Beobachter es gibt. Dieser Effekt wird in der psychologischen und sozialpsychologischen Literatur durch drei Faktoren erklärt:
Es kann zunächst eine kognitive Umdefinition der Situation stattfinden, welche moralische Rechtfertigungen zulässt. So wird, wie aus der Analyse hervorgeht, der Protest einer blauäugigen Frau gegen das Vorlesen einer diskriminierenden Aussage als „Standhaftigkeit“ angesehen und nicht als Protest gedeutet:
Braunäugige Teilnehmerin: Sie war wirklich sehr standhaft und hat einfach sich nicht verbiegen lassen in dem Moment. Sie wollte nicht vorlesen, weil sie der Meinung war, dass sie das dann irgendwo verinnerlicht oder annimmt, wenn sie diese Sachen ausspricht. Es ging glaube ich um das Plakat: Einen Blauäugigen soll meine Tochter nicht nach Hause nehmen (Transkript 9).
Diese Umdefinition heißt in der Fachliteratur kognitive Restrukturierung.
Des Weiteren werden in solchen Situationen leicht zugängliche kognitive Schemata, also solche, die bereits häufig verwendet wurden, mit größerer Wahrscheinlichkeit auf mehrdeutige Situationen angewandt als konkurrierende Schemata, die nicht so leicht zugänglich sind. So wird erneut die „Standhaftigkeit“ blauäugiger Teilnehmer:innen als störend angesehen; sie werden als „Spielverderber“ bezeichnet und es wird ignoriert, dass es um beleidigende Aussagen über die Gruppe oder sehr unangenehme Situationen geht:
Braunäugige Teilnehmerin: Lies es einfach vor. Es ist doch nicht zu schwierig. Meike, warum fragst du jetzt wieder was drankommt? Das ist jetzt wirklich für jeden hier im Raum sehr logisch (Transkript 7).
Diese Situation wird als Reduktion von Unsicherheit bezeichnet.
Zuletzt zeigt sich folgendes: Je mehr Informationen bezüglich einer außergewöhnlichen Situation unter den Teilnehmer:innen zirkulieren, desto weniger fühlt sich jeder einzelne verantwortlich, Hinweise zu geben oder einzuschreiten. Davon zeugt am besten die Episode, in der alle braunäugigen Teilnehmer:innen aufgestanden sind, um zu zeigen, dass sie den Test bestanden haben, obwohl ihnen bekannt war, dass sie dies nur geschafft hatten, weil sie die Ergebnisse vorab bekommen hatten (Transkript 12):

Dieses Vorgehen wird als Diffusion von Verantwortung bezeichnet.
Ausgehend von einer soziologischen Perspektive kann man die Zuschauereffekte in die Tradition der Theorien rationaler Wahl einordnen.[7] Diese besagen, dass die Akteure ein rationales Verhalten aufweisen und aufgrund gewisser Präferenzen nutzenmaximierend handeln. Die Präferenzen äußern sich durch drei Entscheidungsmodelle, die sich durch die Videoanalyse bestätigen lassen:
Anfangs empfinden die Teilnehmer:innen das Einschreiten als zu riskant, denn sie sehen, selbst wenn sie zu der privilegierten Gruppe gehören, dass sie bei einem nicht erwünschten Verhalten schnell aus dem Workshop entlassen werden. Als eine braunäugige Teilnehmerin zu einem frühen Zeitpunkt ihre Bedenken über den Umgang mit der anderen Gruppe äußert, wird sie gebeten, den Workshop zu verlassen (vgl. Transkript 3). Nach den Annahmen der Rational-Choice Theorie ist zu erwarten, dass wenige oder keine weiteren Teilnehmer:innen folgen, denn der Protest wird als eine zu riskante Aktion empfunden.
Des Weiteren wird durch das Experiment an sich die Rollenverteilung bestimmt, die eine gewisse Dynamik mit sich bringt. Der Kursleiter wird als eine Autoritätsperson angesehen und die Akteure vertrauen ihm, dass keine unerwünschten Grenzen überschritten werden. Diese Annahme äußern sie auch offen während des Workshops:
Braunäugige Teilnehmerin: […] Und ich hab schon ein, zwei Leute angesprochen. Die haben gesagt: Neee, wird schon nicht so schlimm sein. Die werden auch ihren Kaffee kriegen oder sonst was. […] (Transkript 3).
Zuletzt stellen sich die rational-ökonomischen Akteure die Frage: „Warum ich und nicht du?“ So erscheint es wenig rational, als erster mit Zugeständnissen anzufangen, wenn es doch eine ganze Gruppe (Gleichgesinnter) gibt, die hier ebenfalls eine Vorreiterposition einnehmen könnten. Warum sollte man selbst also die möglichen negativen Konsequenzen tragen?
Die Theorie rationaler Wahl hilft uns zu verstehen, warum es in bestimmten Situationen rational ist, diese stillschweigend hinzunehmen, um die Spielregeln des Workshops nicht zu verletzten. An die Grenzen ihres Erklärungspotenzials stößt die Theorie jedoch bei der Frage, wie es dem Kursleiter gelang, die Braunäugigen von der vermeintlichen Unfähigkeit der Blauäugigen zu überzeugen.
Aus einer weiteren sozialpsychologischen Perspektive ist es nicht verwunderlich, dass die Gruppe z. B. einer offensichtlichen Lüge zustimmt (vgl. Transkript 3). Diese Situation ist vergleichbar mit dem Experiment von Robert Rosenthal und Lenore F. Jacobson aus dem Jahr 1966. Die Forscher führten ein Experiment an Schulen durch, um herauszufinden, wie sehr die Leistungen von Schülern von der Überzeugung der Lehrer abhängen – die Ergebnisse waren erstaunlich: Am Ende des Schuljahres bekamen tatsächlich die Schüler, die besonders von den Lehrern gefördert wurden und von denen diese dachten, sie hätten einen höheren IQ als der Rest, viel bessere Noten, obwohl dies überhaupt nicht zutraf. Diesen Effekt, der auf die Situation aus dem Workshop sehr gut übertragbar ist, nannten sie „Pygmalion-Effekt“.[8]
Zur Videoanalyse als Methode kann hier festgestellt werden, dass ihre Vorteile in der Verbindung von visuellen und auditiven Komponenten liegen. Im Vergleich mit den Gedächtnisprotokollen einer teilnehmenden Beobachtung stützt man sich in der hermeneutischen Analyse auf mehr Aspekte als lediglich Text. Dementsprechend ist die Erklärung an manchen Stellen tiefgründiger, denn durch das Visuelle können z. B. Emotionen, bestimmte Reaktionen und Gruppendynamiken besser erfasst werden. Der dokumentarische Charakter ist gleichzeitig auch eine Einschränkung, weswegen die Videoanalyse als Methode in den meisten Fällen am sinnvollsten als Teil einer Methodenkombination verwendet wird, z. B. mit einer teilnehmenden Beobachtung im Rahmen eines größeren Vorhabens, welches auf der Grounded-Theory-basiert.
Videomaterial:
ZDFneo (2014): Der Rassist in uns (74’), Deutschland.
Zentraler Text für die Auswertung:
Schnettler, Bernt und Hubert Knoblauch (2009): „Videoanalyse“, in: Stefan Kühl, Petra Strodtholz und Andreas Taffertshofer (Hrsg.): Handbuch Methoden der Organisationsforschung: Quantitative und Qualitative Methoden, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 272–297.
Quellen:
Berger, Peter und Thomas Luckmann (1969): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Frankfurt am Main: Fischer.
Fischer, Peter, Joachim I. Krueger, Tobias Greitemeyer, Claudia Vogrincic, Andreas Kastenmüller, Dieter Frey, Moritz Heene, Magdalena Wicher und Martina Kainbacher (2011): “The bystander-effect: a meta-analytic review on bystander intervention in dangerous and non-dangerous emergencies,” in: Psychological Bulletin137 (4), S. 517–537.
Goodwin, Charles (1994): “Recording human interaction in natural settings,” in: Pragmatics 3 (2), S. 181–209.
Goodwin, Charles (2000): “Practices of Seeing: Visual Analysis: An Ethnomethodological Approach”, in: Theo Van Leeuwen und Carey Jewitt (Hrsg.): Handbook of Visual Analysis, London u. a.: SAGE, S. 157–182.
Heath, Christian (1997a): “The Analysis of Activities in Face-to-Face Interaction Using Video,” in: David Silverman (Hrsg.): Qualitative Research: Theory, Method, and Practice, London u. a.: SAGE, S. 183–200.
Heath, Christian (1997b): “Video and Sociology: The Material and Interactional Organization of Social Action in Naturally Occuring Settings,” in: Champs visuels 6, S. 37–46.
Heath, Christian und Jon Hindmarsh (2002): “Analysing Interaction: Video, Ethnography and Situated Conduct,” in: Tim May (Hrsg.): Qualitative Research in Action, London u. a.: SAGE, S. 99–121.
Heath, Christian, Jon Hindmarsh und Paul Luff (2010): Video in Qualitative Research, London u. a.: SAGE.
Hussain, Insiya, Rui Shu, Subrahmaniam Tangirala und Srinivas Ekkirala (2019): “The Voice Bystander Effect: How Information Redundancy Inhibits Employee Voice,” in: Academy of Management Journal 62 (3), S. 828–849.
Knoblauch, Hubert (1995): Kommunikationskultur: Die kommunikative Konstruktion kultureller Kontexte, Berlin: de Gruyter.
Knoblauch, Hubert (2001): „Fokussierte Ethnographie“, in: sozialersinn 2 (1), S. 123–141.
Latané, Bibb und John M. Darley (1968): “Group inhibition of bystander intervention in emergencies,” in: Journal of Personality and Social Psychology 10 (3), S. 215–221.
Latané, Bibb und Steve A. Nida (1981): “Ten Years of Research on Group Size and Helping,” in: Psychological Bulletin 89 (2), S. 308–324.
Liebst, Lasse S., Richard Philpot, Marie B. Heinskou und Marie R. Lindegaard (2018): “Bystander Intervention in Street Violence: Current Evidence and Implications for Practice,” in: Samfundsøkonomen 4, 1–10.
Luckmann, Thomas (1988): „Kommunikative Gattungen im kommunikativen Haushalt einer Gesellschaft“, in: Giesela Smolka-Kordt, Peter M. Spangenberg und Dagmar Tillmann-Bartylla (Hrsg.): Der Ursprung der Literatur: Medien, Rollen, Kommunikationssituationen zwischen 1450 und 1650, München: Fink, S. 279–288.
Luckmann, Thomas (2002): „Der kommunikative Aufbau der sozialen Welt und die Sozialwissenschaften“, in: ders.: Wissen und Gesellschaft, Konstanz: UVK, S. 157–181.
Luckmann, Thomas (2006): „Die kommunikative Konstruktion der Wirklichkeit“, in: Dirk Tänzler, Hubert Knoblauch und Hans-Georg Soeffner (Hrsg.): Neue Perspektiven der Wissenssoziologie, Konstanz: UVK, S. 15–26.
Meleghy, Tamás (2015): „Rational Choice Theory: James S. Coleman“, in: Julius Morel, Eva Bauer, Tamás Meleghy, Heinz-Jürgen Niedenzu, Max Preglau und Helmut Staubmann: Soziologische Theorie: Abriss der Ansätze ihrer Hauptvertreter, Berlin u. a.: De Gruyter Oldenbourg, S. 99–134.
Pohlmann, Markus (2021): “The Silence of Organizations – On the Difficulties of Organizations in Detecting Crimes”, in: Sebastian Starystach und Kristina Höly (Hrsg.): The Silence of Organizations – How Organizations Cover Up Wrongdoings, Heidelberg: heiBOOKS, S. 45–68.
Raab, Jürgen (2001): „Medialisierung, Bildästhetik, Vergemeinschaftung. Ansätze einer visuellen Soziologie am Beispiel von Amateurclubvideos“, in: Thomas Knieper und Marion G. Müller (Hrsg). Kommunikation visuell. Das Bild als Forschungsgegenstand – Grundlagen und Perspektiven, Köln: Herbert von Halem, S. 37–63.
Raab, Jürgen (2002): „‚Der schönste Tag des Lebens‘ und seine Überhöhung in einem eigenwilligen Medium. Videoanalyse und sozialwissenschaftliche Hermeneutik am Beispiel eines professionellen Hochzeitsvideofilms“, in: sozialersinn 3, S. 469–495.
Raab, Jürgen und Dirk Tänzler (1999): „Charisma der Macht und charismatische Herrschaft. Zur medialen Präsentation Mussolinis und Hitlers“, in: Anne Honer, Ronald Kurt und Jo Reichert (Hrsg.): Diesseitsreligion. Zur Deutung der Bedeutung moderner Kultur, Konstanz: UVK, S. 59–77.
Reichert, Jo und Carina Jasmin Englert (2011): Einführung in die qualitative Videoanalyse: Eine hermeneutisch-wissenssoziologische Fallanalyse, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Rosenthal, Robert und Lenore Jacobson (1983): Pygmalion im Unterricht. Lehrererwartungen und Intelligenzentwicklung der Schüler, Weinheim: Beltz.
Schnettler, Bernt (2001): „Vision und Performanz. Zur soziolinguistischen Gattungsanalyse fokussierter ethnografischer Daten“, in: sozialersinn 1, S. 143–163.
Schleicher, Jürgen und Sabine Sommer (2016): „Setting up to fail! – Wie das Brown Eyed/Blue Eyed – Trainingskonzept die Auswirkungen von Diskriminierungen in Unternehmen erklärbar macht“, in: Günther Vedder und Florian Krause (Hrsg.): Personal und Diversität, Schriftenreihe zur interdisziplinären Arbeitswissenschaft 5, München und Mering: Rainer Hampp Verlag, S. 151–167.
Stübing, Jörg (2004): Grounded Theory: Zur sozialtheoretischen und epistemologischen Fundierung des Verfahrens der empirisch begründeten Theoriebildung, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Wikipedia (2021): „Jane Eliott“. Zugegriffen am 7.3.2021.
Weiterführende Literatur:
Tuma, René, Bernt Schnettler und Hubert Knoblauch (2013): Videographie: Einführung in die interpretative Videoanalyse sozialer Situationen, Wiesbaden: Springer VS.
Verhaag, Bertram (1996): Blue Eyed (90’), Deutschland.
[1] Zur Biografie s. Wikipedia (2021): „Jane Elliott“.
[2] Dieses Verfahren ähnelt dem sequenzanalytischen Verfahren des „hermeneutischen Zirkels“; siehe dazu Kapitel 2 im Buch.
[3] Die vollständige Transkription ist im Anhang zu finden.
[4] Zu dieser Ausrichtung s. Heath 1997a, Goodwin 1994, 2000, Heath 1997b, Heath und Hindmarsh 2002.
[5] In den letzten dreißig Jahren wurde Konstruktivismus in dieser Entwicklungslinie zur Theorie und Methode eines kommunikativen Konstruktivismus fortentwickelt; s. dazu Knoblauch 1995, Luckmann 2002, 2006.
[6] Mehr dazu bei Latané und Darley 1968, Latané und Nida 1981, Fischer et al. 2011, Liebst und Philpot 2018, Hussain et al. 2019 u.v.a. Ein anschauliches Beispiel für Zuschauereffekte in Organisationen ist bei Pohlmann 2021 zu finden.
[7] Im Folgenden wird Rational-Choice Theorie nach Coleman herangezogen; siehe grundlegend dazu Meleghy 2015: 99–134.
[8] Zu dem Pygmalion-Effekt s. Rosenthal und Rosenthal 1983.