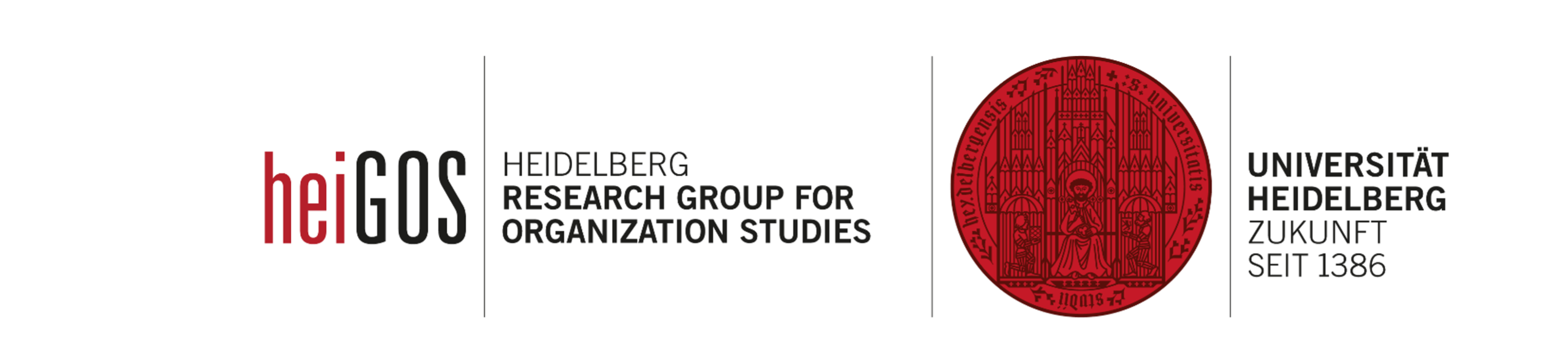- Wie können Experimente dazu beitragen, das Problem der sozialen Erwünschtheit*, das im Antwortverhalten von Befragten häufig zum Tragen kommt, zu vermeiden?
Bei der sozialen Erwünschtheit orientieren sich Befragte an sozialen Normen, um so zu antworten, wie sie annehmen, dass es den Erwartungen der Interviewer*innen oder anderer Beobachter*innen entspricht. Eine Forschung, in welcher Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden untersucht werden soll, stößt mit großer Wahrscheinlichkeit auf Probleme sozialer Erwünschtheit. Viele werden dazu tendieren, die gesellschaftlichen Erwartungen an Hilfsbereitschaft in ihr Antwortverhalten einzubeziehen, um soziale Konformität zu signalisieren. In einem Experiment kann man dies z. B. vermeiden, indem man die Proband*innen in Interaktionssituationen bringt, in denen sie spontan und unter selbstverständlichem Rückgriff auf ihren kulturellen Wissensvorrat agieren und reagieren müssen. Zugleich wird ein anderer Fokus in den Mittelpunkt gerückt und nicht direkt oder indirekt auf „Fremde“ Bezug genommen. Das Experiment von ZDFneo „Der Rassist in uns“ von 2014 wendet genau diese Vorgehensweise an. Rassismus wird hier in einem Experiment getestet (vgl. ZDFneo (2019): Der Rassist in uns (letzter Aufruf 08.12.2020)). Die Teilnehmer*innen wussten vorher nicht, was sie erwarten wird und reagierten spontan auf die entstandene Situation. In dem Antirassismus-Training wurden sie anfangs anhand ihrer Augenfarbe in zwei Gruppen eingeteilt. Mit der Augenfarbe wurde ein Merkmal in den Fokus gerückt, welches normalerweise weder diskriminiert wird noch Gegenstand von Fremdenfeindlichkeit ist. Die Blauäugigen werden von Beginn an auf verschiedenste Arten gedemütigt und schlecht behandelt, während die Braunäugigen Anerkennung erfahren und erleben, wie stark das Gefühl von Macht im Team sein kann. So erleben die Teilnehmer*innen am eigenen Leib, was es heißt, diskriminiert zu werden und wie leicht es passiert kann, selbst zu diskriminieren. All diese Effekte lassen sich in einem solchen Experiment beobachten, ohne dass soziale Erwünschtheit ins Spiel kommt (siehe auch Übung für Zuhause 5: Die Beobachtung eines Experiments, in diesem Buch).
*Das wäre in diesem Fall ein Verhalten, welches auf gesellschaftliche Erwartungen reagiert, dass man sich im Umgang mit Geflüchteten wohlmeinend gibt.
- Welche ethischen Grenzen kann man mit Experimenten überschreiten? Bitte nennen Sie Beispiele dafür.
Da Experimente teilweise verdeckt stattfinden und die Teilnehmer*innen erst im Nachhinein aufgeklärt werden können, besteht je nach Art der Vorgehensweise das Risiko, ethische Grenzen zu überschreiten. Insbesondere der Aufklärungspflicht der Proband*innen über das geplante Experiment und die damit verbundenen Risiken kann im Falle von Krisenexperimenten nicht bzw. erst nach dem Experiment nachgekommen werden. Krisenexperimente sind daher nach dem Prinzip der minimalen Intervention gestaltet, d. h., die Forschenden sollten möglichst geringfügige Abweichungen von Alltagssituationen vorsehen und sind verpflichtet, im Nachhinein ihrer Aufklärungspflicht nachzukommen und die Proband*innen umfassend einzuweihen.
- Welche Probleme der Generalisierung der Ergebnisse stellen sich bei standardisierten, quantitativ orientierten Experimenten und welche bei qualitativen Experimenten?
Unter dem Begriff der externen Validität wird das Problem der Generalisierung sowohl bei quantitativ wie qualitativ orientierten Experimenten diskutiert. Quantitative Experimente zielen meistens auf die Prüfung eines theoretischen Satzes oder einer Hypothese. Die Isolierung hypothesenrelevanter Variablen ist dabei die Voraussetzung zur Bestimmung der kausal verstandenen Abhängigkeiten. Diese werden durch eine Manipulation der Untersuchungsbedingungen, idealerweise nur der test-unabhängigen Variablen untersucht, während alle anderen Variablen konstant gehalten werden. Wegen ihrer besseren Kontrollierbarkeit werden solche Experimente nach Möglichkeit unter Laborbedingungen vorgenommen. Die Fixierung der Untersuchungsbedingungen, insbesondere Laborbedingungen, stellt aber die externe Validität infrage. Es bleibt unklar, inwieweit sich diese Zusammenhänge auch außerhalb des Labors, also im Feld mit seinen ganz anderen Mechanismen finden lassen. Das erschwert deren Generalisierung. Aus Sicht des quantitativen Paradigmas stellt sich bei qualitativen Feldexperimenten das Problem der internen Validität, d. h., es bleibt aufgrund des Einflusses vieler verschiedener Faktoren unklar, welche Zusammenhänge für das gefundene Ergebnis verantwortlich sind. Aber qualitative Experimente sind keine Hypothesentests. Die Bedingungen werden in qualitativen Experimenten nicht streng kontrolliert, sondern variiert und verglichen. Das Experiment wird nicht jedes Mal auf exakt dieselbe Weise wiederholt, sondern Kontexte, Testpersonen, Instruktionen etc. werden nach Maßgabe der Theorieentwicklung immer wieder variiert. In dieser Offenheit des Prozesses liegt jedoch aus Sicht des quantitativen Paradigmas die Problematik der internen und externen Validität begründet. In der Perspektive der qualitativen Sozialforschung gelten auch hier die üblichen Gütekriterien qualitativer Repräsentanz.