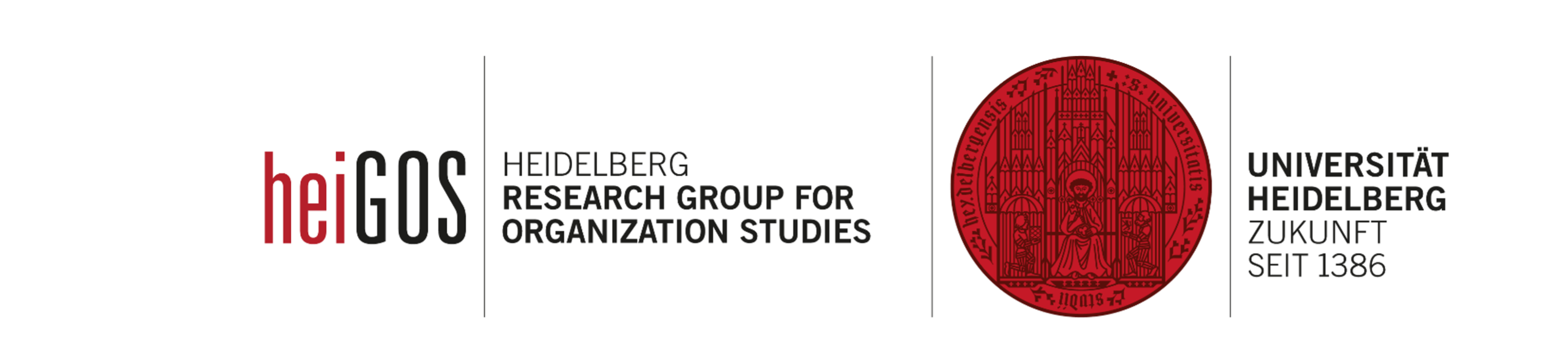- Aus welchen Gründen heraus wird in der qualitativen Sozialforschung die Induktion gegenüber deduktiven Verfahren bevorzugt?
Die meisten Ansätze in der qualitativen Sozialforschung folgen dem Prinzip, Theorien aus der Empirie heraus zu entwickeln und dies Schritt für Schritt im Vergleich verschiedener und ähnlicher Fälle zu tun. Aus der Vorstellung heraus, dass es weniger sinnvoll ist, Theorien am Schreibtisch zu entwickeln und diese dann mühsam mit der Empirie abzugleichen, werden induktive Verfahren der Theorieentwicklung aus der Empirie heraus bevorzugt. Um andere Lebenswelten kennenzulernen und Raum für die Relevanzen der Handelnden im Feld zu entwickeln, eignet sich aus Sicht der meisten qualitativ Forschenden die induktive Herangehensweise am besten.
- Wie kann man induktive und deduktive Herangehensweisen kombinieren? Bitte führen Sie dies an einem Beispiel aus.
Bei manchen Fragestellungen ist es sinnvoll, induktive und deduktive Herangehensweisen zu kombinieren. Wenn die Fragestellung selbst bereits Annahmen oder Theorien voraussetzt, kann man diese offenlegen sowie begründen und im Anschluss daran dennoch unstrukturiert und offen mit dem empirischen Material umgehen. Diese Theorie- und Hypothesenentwicklung aus dem Material heraus kann dann sowohl die Annahmen korrigieren oder widerlegen als auch zur Weiterentwicklung der ursprünglich vorausgesetzten Theorie beitragen. So können wir beispielsweise Kontaktanzeigen mit der Frage analysieren, inwiefern sie darauf ausgerichtet sind, eine homophile, statusgleiche Nachfrage an möglichen Partner*innen anzuziehen. Um den Status zu bestimmen, nutzen wir deduktiv orientiert die Bourdieusche Kapitalientheorie, aber gehen von dieser ausgehend induktiv mit den Kontaktanzeigen um. Wir unterziehen sie zum Beispiel einer qualitativen hermeneutischen Analyse und kommen im Vergleich der Kontaktanzeigen zu dem Ergebnis, dass sich Statussignale in Kontaktanzeigen in „Die Zeit“ am häufigsten auf das kulturelle Kapital beziehen. Aber zugleich sehen wir auch, dass Kontaktanzeigen viele Lebensstilsignale enthalten, die sich nicht dem Bourdieuschen Kapitalienansatz fügen, sondern auch auf das Milieu verweisen, welches die Kontaktanzeige signalisiert (siehe dazu Kap. 6.5 Die Analyse von Kontaktanzeigen – Ein Anwendungsbeispiel in der Kombination quantitativer und qualitativer Inhaltsanalyse, in deisem Buch).
- Wenn man Theorien und Hypothesen aus dem Material heraus entwickelt, muss man sie dann nochmals quantitativ testen?
Das Ergebnis einer qualitativen Untersuchung zielt nicht auf eine quantitative Generalisierung ab, welche sich in einer statistischen Repräsentativität äußert, sondern auf eine qualitative Repräsentativität entlang der Gütekriterien qualitativer Forschung, inklusive des Erreichens einer theoretischen Sättigung. Sie müssen daher nicht mehr quantitativ getestet werden und oft geht dies auch gar nicht, da ein standardisierter Zugang in einer bestimmten qualitativen Tiefe oder auf einem bestimmten Forschungsfeld unter Beibehaltung der Fragestellung gar nicht möglich ist. Dort wo es aber möglich ist, kann natürlich im Sinne einer Triangulation ein quantitativer Test auf Basis der qualitativen Befunde angestrebt werden.
- Wie viele Fälle braucht man in der qualitativen Sozialforschung, um die Befunde generalisieren zu können?
Es gibt keine im Vorhinein festgelegte Anzahl von Fällen. Für einen Vergleich von Fällen ist die Mindestanzahl drei Fälle. Man kann von einem Fall ausgehend einen minimal variierenden Fall auswählen und fragen, was unter ansonsten ähnlichen Bedingungen noch die Unterschiede sind, sowie einen maximal kontrastierenden Fall zum Vergleich heranziehen. Dann kann man fragen, was unter diesen Bedingungen noch die Gemeinsamkeiten sind. Die weitere Anzahl der Fälle bestimmt sich z. B. nach dem Prinzip der theoretischen Sättigung. Sie ist erreicht, wenn die Auswertung aller weiteren Fälle – außer den Details der Fälle – keine neuen Erkenntnisse mehr bringt. Die Generalisierung wird in der qualitativen Sozialforschung nicht durch die Anzahl sowie die statistisch repräsentative Auswahl von Fällen erreicht, sondern durch eine qualitative Repräsentativität entlang der Gütekriterien qualitativer Forschung, ggf. inklusive des Erreichens einer theoretischen Sättigung.