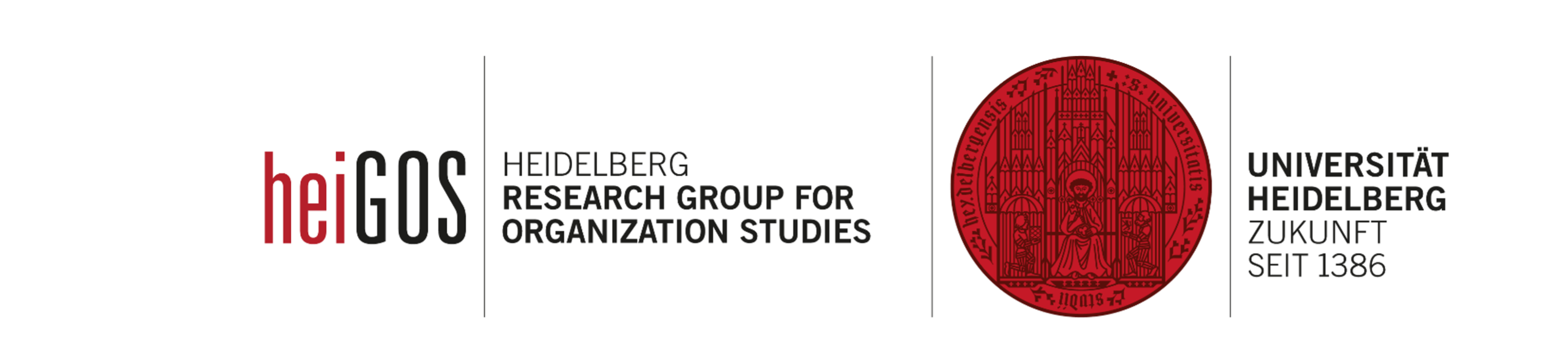- Wieso können narrative Interviews einen Zugang zu Themen bieten, über welche ansonsten nicht offen gesprochen würde?
Sehr oft ist es so, dass Themen, für die sich die Forschenden interessieren, in Interviews nicht direkt oder offen angesprochen werden können. Dies hat den Grund, dass sie entweder zu Reaktanz, zu sozial erwünschten Antworten oder zu Artefakten führen würden. Wenn wir also z. B. etwas über Macht oder politischen Einfluss erfahren wollen, macht es keinen Sinn, die Befragten direkt darauf anzusprechen, über wie viel Macht oder Einfluss sie verfügen. Oder wenn wir etwas darüber wissen wollen, wie Eltern tatsächlich mit ihren Kindern umgehen oder wie jemand tatsächlich zu Geflüchteten stehen, führt eine offene und direkte Frage oft nur zu sozial erwünschten Antworten. Die Generierung von Erzählungen bietet dazu eine Alternative. Indem man die Befragten über ihren Werdegang, über ihre Freunde und Bekannte oder über ein Ereignis in ihrer Stadt oder bei ihrer Arbeit erzählen lässt, werden oft viele Dinge miterzählt, welche einen Zugang zu Fragen von Macht und Einfluss eröffnen. Oder wenn man Eltern über ein großes Familienfest, die Großeltern oder ihre eigene Erziehung erzählen lässt, kommen en passant viele Sachverhalte zur Sprache, mit denen sich Bezüge zu ihrem Umgang mit ihren Kindern herstellen lassen. Dafür verantwortlich zeichnen die sog. Erzählzwänge, denen Stehgreiferzählungen unterliegen. Wir beginnen bei einem Ereignis, müssen dann aber mehr und anderes erzählen, damit die Fragenden den Vorgang verstehen (Detaillierungszwang), aber zugleich immer wieder einen roten Faden herstellen (Kondensierungszwang) und die Erzählung auch zu einem Abschluss bringen (Gestaltschließungszwang). Wie wir auch aus dem Alltag kennen, führen Erzählungen oft dazu, über mehr und anderes zu sprechen als beabsichtigt. Diese Erzählzwänge nutzen erzählgenerierende Interviews, um etwas über Relevanzen der Befragten zu erfahren, die ansonsten gerne verdeckt oder hinter der Fassade sozial erwünschter Antworten verborgen werden.
- Für welche Fragestellungen sind teilstandardisierte Expert*inneninterviews besser geeignet als narrative Interviews?
Für Fragestellungen, bei welchen es auf Argumentations- und Beschreibungstexte sowie auf Einstellungen und Werthaltungen ankommt, sind teilstandardisierte Expert:inneninterviews oft besser geeignet. Sie eröffnen zusätzliche Möglichkeiten der Fragebogenkonstruktion, wie z. B. Trichterfragen, in denen Argumente und Positionen punktgenau abgefragt werden können. Insbesondere wenn das Feld bereits besser bekannt und qualitativ erschlossen ist, können teilstandardisierte Expert:inneninterviews eine gute Ergänzung, Präzisierung und Fokussierung von Fragestellungen darstellen.
Teilstandardisierte Expert:inneninterviews zeichnen sich dadurch aus, dass Expert:innen zu dem vorher ausgewählten Thema gefunden werden müssen und Fragen gestellt werden können, die das Thema inhaltlich weiterbringen. Durch die Teilstandardisierung des Expert:inneninterviews ist mehr Offenheit möglich als bei voll standardisierten und strukturierten Interviews. Es ist zwar durch einen Leitfaden vorbereitet, aber in der Durchführung frei gestaltbar. Diese Art von Interviewform ist vor allem geeignet, wenn ein Thema gewählt wird, für das noch wenig generalisierbare Ergebnisse vorliegen. Es ist außerdem sinnvoll, wenn man einen sehr spezifischen Bereich oder ein spezifisches Berufsfeld untersuchen möchte oder wenn die Perspektiven oder Verhaltensweisen einer speziellen Gruppe oder Organisation im Mittelpunkt stehen. Expert:inneninterviews sind im Allgemeinen besser dazu geeignet, empirische Fragestellungen zu bearbeiten, denen bereits klare theoretische Vorannahmen zugrunde liegen. Zudem bieten sie sich an, wenn der Zugang zu den Erfahrungen, Relevanzstrukturen und der Lebensgeschichte der Befragten nicht im Vordergrund steht, sondern Begründungszusammenhänge, Argumentationen und Wissensstrukturen von Interesse sind.
- Sie wollen Interviews zu dem Thema durchführen, dass junge Menschen häufig Kunden von Fast-Fashion-Modeläden (wie z. B. H&M, Primark etc.) sind, auch wenn sie um die soziale Ungleichheit undmangelnde Nachhaltigkeit eines solchen Konsums wissen. Welche und wie viele Interviews würden Sie mit wem durchführen? Bitte begründen Sie Ihre Vorgehensweise.
Durch den Bezugspunkt der Mode haben wir es zum einen mit Phänomenen der Nachahmung sowie der Abgrenzung zwischen gesellschaftlichen Schichten zu tun (vgl. z. B. Simmel 1991; Goblot 1994). Zum anderen werfen Fragen zu Werthaltungen und daran orientierte Handlungsweisen (Konsumverhalten) Probleme der Antwortverzerrung in Richtung sozialer Erwünschtheit aus. Um diesen zu begegnen, bietet sich eine Interviewform mit erzählgenerierenden Fragen an. Zugleich sollen die Interviews aber auch fokussiert auf den Themenbereich ausgerichtet sein. Aus diesen Gründen liegt hier die Durchführung eines problemzentrierten Interviews nahe. Trotz der Existenz theoretischer Vorannahmen sind im Themenbereich des nachhaltigen Modekonsums Relevanzstrukturen von besonderer Bedeutung, zu denen wir insbesondere durch erzählgenerierende und offene Fragetechniken einen Zugang bekommen. Zugleich legt das Thema die Existenz eines moralischen Konflikts beim Modekauf in Fast-Fashion-Ketten nahe. Um diese Möglichkeit empirisch zu erhellen, sollte das Interviewmaterial Beschreibungen der persönlichen Einkaufssituation und insbesondere auch Argumentationen zur Begründung des eigenen Konsumverhaltens enthalten.
Wichtig wäre es hier aber, in der Vorgehensweise unser theoretisches Vorwissen so weit wie möglich zurückzustellen und induktiv vorzugehen. Es bietet sich daher z. B. mit dem gewählten Bezugspunkt der Grounded Theory ein theorieorientiertes Sampling (theoretical sampling) an, bei dem die Fallzahl nicht im Vorhinein festgelegt ist. Auch die genaue Auswahl bestimmt sich dann nach einem kontrastierenden Verfahren des Fallvergleiches. Sicherlich würden wir aber mit jugendlichen Konsumenten (15–18 Jahre) sowie jungen Erwachsenen (18-30 Jahren) beginnen, da diese mutmaßlich neben Eltern, die dort Kinderkleidung kaufen, zur Zielgruppe der Fast-Fashion-Geschäfte gehören.
Eine sinnvolle Erweiterung des Forschungsdesigns könnte darin bestehen, problemzentrierte Interviews mit Marketing-Expert:innen großer Modeketten zu führen, um zusätzliche Beschreibungen der Vertriebspraxis von Fast-Fashion zu erhalten.
Literatur zum Thema Mode:
Goblot, Edmond (1994 [1925]): Klasse und Differenz. Soziologische Studie zur modernen französischen Bourgeoisie, Konstanz/St. Gallen: Universitätsverlag, S. 87–111.
Simmel, Georg (1991 [1911]): „Die Mode“, in: Silvia Bovenschen (Hrsg.): Die Listen der Mode, Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 179–207.